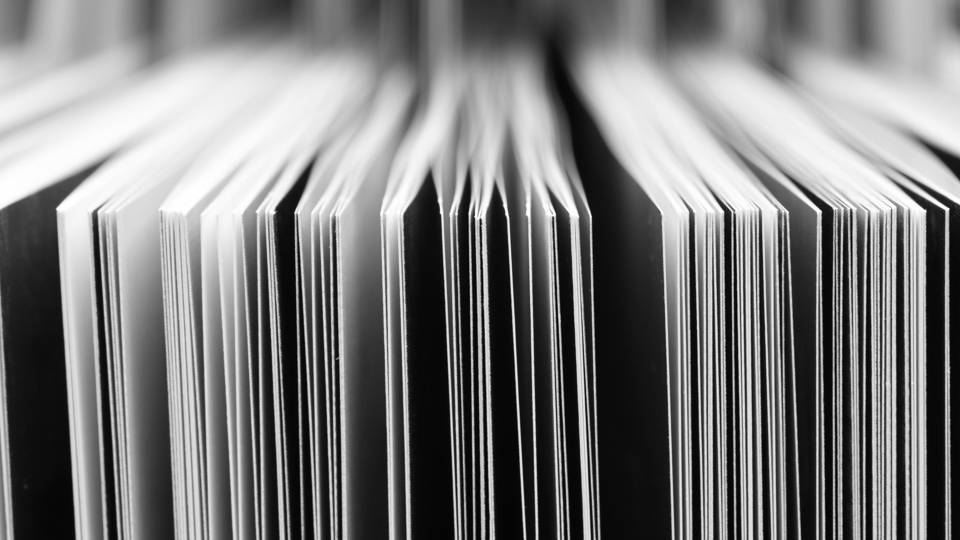Unternehmen zahlen, Organe haften? Zur Regressfähigkeit von Kartellbußgeldern unter Art. 101 AEUV
Zugleich Besprechung von BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23 – Geschäftsführerhaftung*
I. Einleitung
Kartellbußgelder können bekanntlich sehr hoch ausfallen. Bei großen Unternehmen, die schwerwiegende und langwierige Kartellrechtsverstöße begehen, können sich Bußgelder in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe einstellen, in Einzelfällen auch da- rüber hinaus.[1] Es verwundert daher nicht, dass sich betroffene Unternehmen fragen, ob sie bei ihren Vorständen bzw. Geschäftsführern Regress nehmen können. Mögliche Anspruchsgrundlagen dafür sind § 93 Abs. 2 AktG gegen Vorstände und § 43 Abs. 1 GmbHG gegen Geschäftsführer. Beide Vorschriften sehen eine Schadensersatzpflicht der Leitungsorgane vor, wenn diese durch schuldhafte Pflichtverletzungen die Gesellschaft schädigen. Verstößt ein Leitungsorgan gegen geltendes Recht, ist dies stets eine Pflichtverletzung (Legalitätsprinzip).[2] Die Haftung im Aktienrecht ist besonders streng. So sieht § 93 Abs. 2 S. 3 AktG eine Pflicht zum Selbstbehalt bei Directors&Officers (D&O)-Versicherungen[3] vor, ein Anspruchsverzicht ist nach § 93 Abs. 4 AktG nur unter engen Voraussetzungen möglich, und bei börsennotierten Gesellschaften verjähren etwaige Ansprüche erst nach zehn Jahren.[4] Im Fall von Kartellrechtsverstößen ist das Unternehmen zunächst durch ein gegen dieses verhängtes Bußgeld geschädigt. Es können aber weitere, substantielle Schadensposten hinzukommen, etwa Verteidigungskosten im Bußgeldverfahren und Kosten wegen Schadensersatzfolgeklagen.
Die Frage nach der Regressfähigkeit von Bußgeldern wird bereits seit längerem in der Literatur intensiv diskutiert: Unter den Befürwortern[5] und Gegnern[6] finden sich jeweils sehr namhafte Vertreter. Unter diesen Vorzeichen war es nur eine Frage der Zeit, bis der Streit den BGH erreichte. Anders als noch die Vorinstanzen hat der BGH die Rechtsfrage jedoch nicht selbst entschieden, sondern das Verfahren ausgesetzt, um dem EuGH eine Vorlagefrage nach Art. 267 AEUV zu stellen. Er möchte wissen, ob Art. 101 AEUV einer Regelung im nationalen Recht entgegensteht, nach der eine juristische Person, gegen die eine nationale Wettbewerbsbehörde ein Bußgeld wegen eines durch ihr Leitungsorgan begangenen Verstoßes gegen Art. 101 AEUV verhängt hat, den ihr dadurch entstandenen Schaden von dem Leitungsorgan ersetzt verlangen kann. Sein Vorlagebeschluss fällt mit 24 Seiten recht umfangreich aus und enthält einige interessante Überlegungen. Dementsprechend lohnt es, die BGH-Entscheidung näher zu betrachten. Dies soll in diesem Beitrag geschehen. Dabei werden zunächst die Ausgangslage und die Entscheidung der Vorinstanzen kurz dargestellt (II.). Sodann wird die BGH-Entscheidung knapp zusammengefasst (III.). Anschließend erfolgt eine kritische Stellungnahme (IV.). Der Beitrag endet mit einem kurzen Fazit (V.).
II. Ausgangslage und Entscheidungen der Vorinstanzen
Die Klägerinnen, zwei konzernverbundene Gesellschaften der Edelstahlbranche, nehmen ihren früheren Geschäftsführer und Vorstand auf Schadensersatz in Anspruch. Das Bundeskartellamt verhängte im Jahr 2018 gegen die Klägerin zu 1) wegen ihrer Beteiligung am sog. Edelstahlkartell eine Geldbuße in Höhe von rund EUR 4,1 Mio. Es handelte sich um ein kartellrechtswidriges Preiskartell, welches zwischen den Jahren 2002 und 2015 bestand. Der Beklagte war hieran unmittelbar beteiligt. Er erhielt deshalb auch ein persönliches Bußgeld in Höhe von EUR 126.000. Die Geldbußen hatten ausschließlich ahndenden Charakter und erfolgten wegen eines vorsätzlichen Verstoßes gegen das Kartellverbot des Art. 101 AEUV.[7]
Die Klägerinnen nahmen sodann den Beklagten nach § 43 Abs. 2 GmbH bzw. § 93 Abs. 2 S. 1 AktG in Regress. Die Klägerin zu 1) verlangt Ersatz des gegen sie verhängten Bußgelds in Höhe von EUR 4,1 Mio. und die Beklagte zu 2) beansprucht den Ersatz von Aufklärungs- und Verteidigungskosten von EUR 1,1 Mio. Das LG Düsseldorf[8] und das OLG Düsseldorf[9] wiesen die Klage ab, weil sie sich der Auffassung anschlossen, wonach Bußgelder nicht regressfähig seien. Das gelte auch für den Ersatz der Aufklärungs- und Verteidigungskosten als akzessorische Schäden. Hiergegen wenden sich die Klägerinnen mit ihrer Revision zum BGH.[10]
III. Zusammenfassung des BGH-Beschlusses
Der BGH merkt zunächst an, dass es bislang nicht höchstrichterlich geklärt sei, ob Gesellschaften ihre Leitungsorgane nach § 43 Abs. 2 GmbH bzw. § 93 Abs. 2 S. 1 AktG für gegen sie verhängte Bußgelder in Regress nehmen können.[11] Eine Auffassung sehe Bußgelder als nicht regressfähig an. Denn beide Vorschriften seien dahingehend teleologisch zu reduzieren, um nicht den Zweck der Geldbuße als Verbandssanktion zu unterlaufen, die das Unternehmen treffen solle. Dieser Ahndungszweck zeige sich auch darin, dass das Bundeskartellamt gegen die Leitungsperson selbst eine eigene (und mit maximal EUR 1 Mio. auch deutlich niedrigere) Geldbuße festsetzen kann. Mithin würde das Abschreckungspotential von Geldbußen verringert, wenn Unternehmen bei ihren Leitungsorgangen Regress nehmen könnten. Die Gegenansicht verweise auf den Wortlaut beider Vorschriften, der keine solche Einschränkung vorsehe, und eine teleologische Reduktion sei auch nicht geboten. Der Sanktionszweck sei nämlich bereits mit der Verhängung der Geldbuße vollständig erfüllt. Ein drohender Regress von Bußgeldern halte die Leitungsorgane zur Beachtung des Kartellrechts an, weil sie im Verstoßfall damit rechnen müssen, selbst im Wege des Schadensersatzes in Anspruch genommen zu werden.[12]
Für die Entscheidung, ob § 43 Abs. 2 GmbH bzw. § 93 Abs. 2 S. 1 AktG teleologisch zu reduzieren ist und somit Bußgelder nicht regressfähig sind, sei erheblich, ob das Unionsrecht der Anwendung beider Vorschriften diesbezüglich entgegenstehe. Ob die Voraussetzungen für eine teleologische Reduktion vorliegen, sei unter alleiniger Berücksichtigung des nationalen Rechts nicht zweifelsfrei.[13] Vor dem Hintergrund der bestehenden BGH- Rechtsprechung sei nämlich zweifelhaft, ob der Zweck der kartellrechtlichen Verbandssanktion oder die Gesetzessystematik mit der erforderlichen Deutlichkeit eine planwidrige Regelungslücke erkennen lassen, und ob der Gesetzgeber es nach seinem Regelungsplan versäumt habe, die Vorschriften über die Organhaftung dahingehend einzuschränken, das Gesellschaften gegenüber ihrem Leitungsorgan wegen eines gegen sie verhängten kartellrechtlichen Bußgelds keinen Regress nehmen dürfen.[14]
Gleichwohl könnte Art. 101 AEUV eine einschränkende Auslegung des nationalen Rechts gebieten.[15] Zwar verhalte sich das Unionsrecht nicht ausdrücklich zu Regressmöglichkeiten bei Verstößen gegen Art. 101 AEUV, doch müssten die Geldbußen nach der Rechtsprechung des EuGH wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.[16] So könnte die danach gebotene Wirksamkeit einer gegen das Unternehmen wegen eines Verstoßes gegen Art. 101 AEUV verhängten Geldbuße beeinträchtigt sein, wenn sich die Gesellschaft von der Bußgeldlast durch einen voll- ständigen oder teilweisen Regress bei ihren Leitungsorganen wirtschaftlich entlasten könnte. Der BGH stellt sodann einige Gedanken zur bisherigen europäischen Rechtsprechung an und erläutert, weshalb D&O-Versicherungen für die Beantwortung der Vorlagefrage keine Bedeutung zukommen.[17]
Schließlich wirft der BGH noch die Frage auf, falls Art. 101 AEUV 8 dem Bußgeldregress entgegenstehe, ob gleiches auch für Kosten der Sachverhaltsaufklärung und für die Rechtsanwaltskosten zur Verteidigung im Bußgeldverfahren gelte.[18] Da der Ersatz dieser Schäden die Wirksamkeit des verhängten Bußgelds nicht beeinträchtige, sollte insoweit jedoch ein Regress möglich sein.[19]
IV. Stellungnahme
Der Beschluss behandelt eine bislang nicht höchstrichterlich geklärte Frage mit erheblicher praktischer Relevanz für Unternehmen und ihre Leitungspersonen. Durch die Vorlage an den EuGH wird eine unionsrechtlich einheitliche Klärung angestrebt. Die Beantwortung durch den EuGH könnte weitreichende Konsequenzen für die Organhaftung und die Compliance-Kultur haben. Auch wenn es sich um eine äußerst komplexe Problematik handelt, die einer tiefergehenden Betrachtung würdig ist, soll sich hier auf Anmerkungen zu drei interessanten Gesichtspunkten beschränkt werden.
1. Zeitpunkt der Vorlage
Zunächst mag es auf den ersten Blick verwundern, weshalb diese praktisch äußerst relevante Frage den BGH erst jetzt erreichte. Vor allem seit Mitte der 2000er-Jahre sind die Kartellgeldbußen stark angestiegen,[20] weshalb sich seitdem die Regressfrage aufgedrängt hat. Zudem sind die gesetzlichen Haftungsregeln für Leitungsorgane streng. Vor allem Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften sind angehalten, derartige Ansprüche zu verfolgen. In der Entscheidung ARAG/Garmenbeck[21] wurde der BGH sehr deutlich dahingehend, dass Regressansprüche zu prüfen und – soweit sie werthaltig sind – regelmäßig zu verfolgen sind. Auch lässt sich angesichts erheblicher Vermögenswerte der Manager bzw. einer bestehenden D&O-Versicherung nicht einfach von einer Anspruchsverfolgung absehen, weil das Leitungsorgan nicht hinreichend liquide ist. Dennoch werden Regressprozesse seitens der betroffenen Gesellschaft nur sehr ungern geführt. Das muss nicht einer falsch verstandenen Rücksichtnahme oder persönlichen Verbundenheit geschuldet sein, sondern kann auch wirtschaftliche Gründe haben. Zum einen wird das Leitungsorgan darauf drängen, dass der Kartellverstoß dem Unternehmen sehr hohe wirtschaftliche Vorteile eingebracht hat. Zum anderen droht in einem Regressprozess eine „Schlammschlacht“, die weitere unschöne Erkenntnisse über das Kartell ans Tageslicht befördern kann. Beides kann für das betroffene Unternehmen mit Blick auf mögliche Folgeprozesse (Schadensersatzfolgeklagen, Regress unter Kartellanten) sehr nachteilig sein.
2. Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage
Ob eine Vorlage im Sinne des Art. 267 AEUV „erforderlich“ ist, ist mit gewissen Fragezeichen versehen. An sich muss die Beantwortung der Vorlagefrage entscheidungserheblich für den Ausgangsrechtsstreit sein. Auch wenn dies ausweislich des Wortlauts von Art. 267 AEUV das vorlegende Gericht zu beurteilen hat, prüft der EuGH dies nach und hat in der Vergangenheit bereits mehrfach[22] Vorlagefragen als unzulässig zurückgewiesen, welche hypothetische Fragestellungen enthielten, die nicht der Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits dienten, sondern lediglich den EuGH zur Abgabe eines Rechtsgutachtens bewegen sollten. Das jüngste Beispiel ist etwa die Vorlagefrage des LG Dortmunds in Sachen Rundholzkartell zur Auslegung des Art. 101 AEUV bei Schadensersatzfolgeklagen, die der EuGH als unzulässig ansah, weil es sich beim Ausgangsverfahren um gar keine solche Klage handelte.[23] Vorliegend stellen sich hinsichtlich der Entscheidungserheblichkeit gewisse Zweifel, weil der BGH sich nicht klar dazu durchringt, der Auffassung zu folgen, welche Bußgelder er für regressfähig hält. Auch wenn er anfangs[24] noch behauptet, dass die Frage, ob das Unionsrecht einem Regress entgegensteht, entscheidungserheblich sei, so begnügt er sich anschließend damit, festzustellen, dass es „nicht zweifelsfrei“ sei, ob die Voraussetzungen eines Regressausschlusses unter alleiniger Berücksichtigung des nationalen Rechts er- füllt seien.[25] Der BGH argumentiert dann sehr umfangreich, weshalb ein Regress nach nationalem Recht möglich sein könnte und benennt auch Gesichtspunkte, welche für ein Regressverbot sprechen. Aller Voraussicht nach dürfte der EuGH die Vorlagefrage trotz der fehlenden eindeutigen Positionierung des BGH für zulässig erachten, weil er deren Erforderlichkeit traditionell nur sehr zurückhaltend prüft und sie widerleglich vermutet.[26] Auch wenn sich hierüber nur spekulieren lässt, dürfte der BGH ein legitimes Motiv für seine fehlende klare Positionierung gehabt haben. Denn er spricht sich beim Regress (zu Recht) für einen Gleichlauf bei Verstößen gegen deutsches und EU-Kartellrecht aus.[27] Hätte er einen Regress nach deutschem Recht für klar gegeben angesehen und hätte der EuGH sodann in Art. 101 AUEV einen Hinderungsgrund für den Regress gesehen, ließe sich sodann nur schwerlich begründen, weshalb bei Verstößen gegen deutsches Kartellrecht ein Regress (ebenfalls) ausscheidet.
3. Regressfähigkeit von Bußgeldern nach Maßgabe des Art. 101 AEUV
Ob ein Regressverbot besteht, ist eine nach deutschem Recht stark umstrittene Frage. Der BGH gibt die für die ein oder andere Auffassung sprechenden Argumente sehr gut wieder und bewertet diese auch. Allerdings wird der EuGH die Problematik rein aus dem Blickwinkel des Art. 101 AEUV beurteilen. Er wird prüfen müssen, ob ein Regress die gebotene Wirksamkeit und Abschreckung der Geldbuße derart untergräbt, dass Unternehmen keine hinreichenden Anreize mehr zur Einhaltung des Art. 101 AEUV haben. Richtigerweise lässt sich den bislang vom EuGH entschiedenen Fällen hierzu nichts entnehmen. Zuvorderst wäre noch an dessen Entscheidung[28] zur steuerlichen Absetzbarkeit von Geldbußen zu denken, welche deren Wirksamkeit beeinträchtigen können. Doch unterscheidet sich die vorliegende Situation maßgeblich. Zwar kann ein möglicher Regress das Unternehmen ebenfalls von der Buße entlasten, doch schafft er zugleich einen Anreiz für dessen Leitungsorgane, Kartellrecht einzuhalten, weil im Verstoßfall eine persönliche Schadensersatzhaftung droht. Das kann sehr abschreckend wirken. Der EuGH- Entscheidung,[29] wonach nationale Regelungen über die zivilrechtliche Verteilung des Bußgelds innerhalb des Konzerns die Wirksamkeit des Bußgelds nicht beinträchtigen, ist ebenfalls nichts zu entnehmen. Denn anders als beim Konzerninnenausgleich wird beim Regress gegenüber Leitungsorgangen das Bußgeld außerhalb der Sphäre der wirtschaftlichen Einheit verlagert, weshalb sich die wirtschaftliche Einheit damit der Buße entledigen kann. Dabei ist dem BGH im Ausgangspunkt zuzustimmen, dass es keinen Unterschied machen kann, ob das Bundeskartellamt (so im vorliegenden Fall) oder die EU-Kommission wegen eines Verstoßes gegen Art. 101 AEUV einschreitet, selbst wenn das Bundeskartellamt – anders als die EU-Kommission – auch persönliche Bußgelder verhängen kann.[30] Es wäre nicht sachgerecht, die Regressfähigkeit der Geldbuße davon abhängig zu machen, welche Behörde sie wegen eines Verstoßes nach Art. 101 AEUV verhängt. Wie der BGH zu Recht betont, widerspräche eine Differenzierung auch der Rechtseinheitlichkeit und der Vorhersehbarkeit von möglichen rechtlichen Folgen.[31] Ein wesentlicher Gesichtspunkt, den der BGH jedoch für unerheblich hält, betrifft die Rolle von D&O-Versicherungen. Nach dessen Ansicht[32] erlauben sie keine generellen Schlussfolgerungen zur Beantwortung der Vorlagefrage, weil ihre Eintrittspflicht maßgeblich von den Umständen des Einzelfalls abhängt, u.a. dem Grad des Verschuldens des Leitungsorgans und den im Einzelfall vereinbarten Versicherungsbedingungen, insbesondere, ob ein Bußgeldausschluss vorhanden sei. Dem ist nicht zu- zustimmen. Auch wenn das Eingreifen der D&O-Versicherung von den jeweils im Einzelfall vereinbarten Versicherungsbedingungen abhängt, stellt sich die Frage, ob nur dann ein Regressverbot unter Art. 101 AEUV gelten sollte, wenn die D&O-Versicherung die Buße übernimmt. Denn in diesem Fall wäre die Wirksamkeit der Geldbuße stark beeinträchtigt, weil weder das Unternehmen selbst noch dessen Leitungsorgane als Unternehmenslenker einen Anreiz zur Einhaltung von Art. 101 AEUV hätten. Vorzugswürdig ist es jedoch, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen und aus Art. 101 AEUV ein Versicherungsverbot abzuleiten oder zumindest einen substantiellen Selbstbehalt. Art. 93 Abs. 2 S. 3 AktG sieht einen Selbstbehalt bereits vor; es fragt sich allerdings, ob dieser mit Blick auf Art. 101 AEUV ausreichend ist.
Wie der EuGH entscheidet, wird sich zeigen. Aus den obigen Gedanken folgt, dass Art. 101 AEUV einem Regress nicht entgegensteht. Für dieses Ergebnis lässt sich auch eine Gleichbehandlung mit anderen Schadensposten anführen. Denn wie der BGH zutreffend anführt, sollte Art. 101 AEUV einem Regress von Verteidigungs- und Aufklärungskosten nicht entgegenstehen, weil diese neben dem Bußgeld stehen und dessen Wirksamkeit nicht beeinträchtigen. Hinzu kommt ein Regress des Leitungsorgans für mögliche Forderungen von Geschädigten aus Schadensersatzfolgeklagen. Diese können sehr empfindlich sein und Bußgelder übersteigen.[33] Schließlich spricht auch ein anderer, mit der Wirksamkeit der Geldbuße nicht verbundener Aspekt, nicht gegen einen Regress. So gebietet der Erhalt der Funktionsfähigkeit der Kronzeugenregelung[34] kein Regressverbot. Die Kronzeugenregelung ist ein wichtiges Instrument zur Aufdeckung von Kartellen und deren Existenz wirkt destabilisierend auf Kartelle. Allerdings werden Leitungsorgane auch bei einem drohenden Regress noch Anreize haben, sich als Kronzeuge zur Verfügung zu stellen. Denn das Unternehmen kann im Gegenzug zu einer vollständigen und umfassenden Kooperation auf mögliche Regressansprüche verzichten. Zwar sieht § 93 Abs. 4 S 3. AktG hierfür Einschränkungen vor, doch fragt es sich, ob in solchen Fällen nicht mit Blick auf Art. 101 AEUV oder aus anderen Gründen (z. B. weil eine Kooperation hilft, das Bußgeld zu reduzieren und damit im Unternehmensinteresse ist) eine teleologische Reduktion der Norm dahingehend vorzunehmen ist, dass ein Verbot des Anspruchsverzichts ausscheidet.
V. Fazit
Sollte der EuGH der hier vertretenen Auffassung folgen, wonach Art. 101 AEUV einem Regress nicht entgegensteht (und stattdessen ein D&O-Versicherungsverbot begründet), hätte dies weitreichende Auswirkungen für die Kartellrechts-Compliance. Denn die Regresshaftung nach deutschem Recht ist streng. Eine Haftung setzt nicht zwingend eine unmittelbare Beteiligung des Leitungsorgans am Kartellrechtsverstoß voraus, sondern bereits die Duldung eines Verstoßes kann ausreichen.[35] Auch ein Fahrlässigkeitsvorwurf, insbesondere ein Organisations- bzw. Überwachungsverschulden, kann ein Verschulden begründen.[36] Dabei ist ein Regress nicht nur gegen Kartelle gerichtete Geldbußen möglich, sondern kommt auch bei anderen Kartellrechtsverstößen, wie Marktmachtmissbräuchen oder anderen vertikalen oder horizontalen Beschränkungen in Betracht. Daneben stellen sich zahlreiche Folgefragen (u.a. Haftung der Leitungsorgane untereinander, Zusammentreffen der Haftung mit Arbeitnehmern,[37] Anrechenbarkeit der durch den Kartellverstoß erlangten Vorteile,[38] Verjährungsbeginn des Regressanspruchs[39]). Selbst wenn der EuGH den Regress ablehnen sollte und damit der Druck zur Kartellrechts-Compliance bei Leitungsorganen geringer ist, bleiben Unternehmen natürlich weiterhin gut beraten, sich an Kartellrecht zu halten, um keine Bußgelder zu riskieren (für die sie dann keinen Regress nehmen können).
Fußnoten:
Dr. René Galle, Hamburg
*Abgedruckt in WRP 2025, 889 ff.
[1] Für einen Überblick zur Bußgeldverhängung siehe die Bußgeldstatistik der EU-Kommission vom 02.06.2025, abrufbar unter: https://competitionpolicy.ec.europa.eu/document/download/b19175c3-c693-410b-b669-27d4360d359c_en?filename=car tels_cases_statistics.pdf. Die bislang höchste Einzelbuße war das Bußgeld der EU- Kommission in Höhe von EUR 4,3 Mrd. gegen Google in Sachen Android (COMP AT.40099, 18.07.2018, 2019/C 402/08).
[2] Ständige BGH-Rechtsprechung (vgl. BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 9 m. w. N. – Geschäftsführerhaftung). Es handelt sich insoweit um keine unternehmerische Entscheidung, weshalb die Business Judgment Rule des § 93 Abs. 1 S. 2 AktG nicht gilt.
[3] Die D&O-Versicherung ist eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die ein Unternehmen für seine Organe und leitenden Angestellten abschließt. Es handelt sich um eine Versicherung zugunsten Dritter, die der Art nach zu den Berufshaftpflichtversicherungen gezählt wird.
[4] Die umgekehrte Darlegungs- und Beweislast der schuldhaften Pflichtverletzung nach § 93 Abs. 2 S. 1 AktG wird bei der Geschäftsführerhaftung nach § 43 Abs. 2 GmbHG analog angewendet. Vgl. OLG Düsseldorf, 27.07.2023 – VI‑6 U 1/22 (Kart), WRP 2023, 1225 ff., Rn. 78 m. w. N.
[5] Fleischer, DB 2014, 345; Fleischer, in: BeckOGK-AktG, Stand: 01.06.2025, § 93 Rn. 260 bis 265; Blaurock, in: Festschrift Bornkamm, 2014, S. 107, 114 f.; Bayer/ Scholz, GmbHR 2015, 449; Koch, in: Festschrift M. Winter, 2011, S. 327, 333 f.; Thole, ZHR 173 (2009) 504, 532 f.; Nietsch, ZHR 184 (2020) 60, 69 bis 78; Nietsch, NJW 2024,471, 474 f.; Drescher, in: Festschrift Möschel, 2021, S. 91; Franck/Seyer, in: Thépot/ Tzanaki, Research Handbook on Competition and Corporate Law, 2025, https://ssrn. com/abstract=4458185, S. 19 ff.; Kersting/May, WuW 2024, 243 und 313; Monopolkommission, Hauptgutachten XXV, Rn. 312 bis 351; LG Dortmund, 14.08.2023 – 8 O 5/22 (Kart), WuW 2023, 573.
[6] Vgl. LAG Düsseldorf, 20.01.2015 – 16 Sa 459/14, ZIP 2015, 829, juris Rn. 151 bis 181; LG Saarbrücken, 15.09.2020 – 7 HKO 6/16, WuW 2021, 64 Rn. 149 bis 152; Verse, in: Scholz, GmbHG, 13. Aufl. 2024, § 43 Rn. 310 bis 314; Dreher, in: Festschrift Konzen, 2006, S. 85, 103 bis 106; Thomas, NZG 2015, 1409; Ackermann, ZHR 179 (2015), 538, 560 f.; Leclerc, Der Kartellbußgeldregress, 2022, S. 220, 223 bis 230; Ost, in: Fest- schrift für D. Schroeder, 2018, S. 589; Wils, WuW 2023, 583, 588 f.; Wagner-von Papp, in: Thépot/Tzanaki, Research Handbook on Competition and Corporate Law, 2025, https://ssrn.com/abstract=4599326, unter IV. B. 2.; Bunte, NJW 2018, 123; Erfurth, in: Der Bußgeldregress im Kapitalgesellschaftsrecht, 2020, S. 248 bis 262; Friedl, ZWeR 2023, 428, 439 bis 443; Beck, NZKart 2023, 654.
[7] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 4 – Geschäftsführerhaftung.
[8] LG Düsseldorf, 10.12.2021 – 37 O 66/20, BeckRS 2021, 62936, Rn. 48 ff.
[9] OLG Düsseldorf, 27.07.2023 – VI‑6 U 1/22 (Kart), WRP 2023, 1225 ff.
[10] Das OLG Düsseldorf, 27.07.2023 – VI‑6 U 1/22 (Kart), WRP 2023, 1225 ff., hatte die Revision zugelassen.
[11] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 12 – Geschäftsführerhaftung.
[12] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 14 – Geschäftsführerhaftung.
[13] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 17 – Geschäftsführerhaftung.
[15] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 27 – Geschäftsführerhaftung.
[16] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 27 – Geschäftsführerhaftung.
[17] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 40 – Geschäftsführerhaftung mit Hinweis auf EuGH, 14.09.2017 – C‑177/16, WRP 2017, 1322, Rn. 68 – AKKA/LAA; EuGH, 18.01.2024 – C‑128/21, WRP 2024, 557, Rn. 110 – Lietuvos notarų rūmai u.a.
[17] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 41 ff. – Geschäftsführerhaftung.
[18] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 45 – Geschäftsführerhaftung.
[19] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 45 – Geschäftsführerhaftung.
[20] Siehe hierzu etwa https://de.statista.com/statistik/daten/studie/158809/umfrage/vom-bundeskartellamt-verhaengte-bussgelder/. Der Anstieg der Bußgelder in Deutschland dürfte maßgeblich dadurch bedingt sein, dass im Jahr 2005 die Mehrerlösmethode abgeschafft wurde.
[21] BGH, 21.04.1997 – II ZR 175/95, ZIP 1997, 883, Rn. 16 ff.
[22] EuGH, 16.07.1992 – C‑83/91, Slg. 1992, I‑4919, Rn. 25 ff. – Meilicke; EuGH, 09.02.1995 – C‑412/93, Slg. 1995, I‑179, Rn. 12, WRP 1995, S.473 ff. – Leclerc-Siplec; EuGH, 21.03.2002, – C‑451/99, Slg. 2002, I‑3193, Rn. 26 – Cura Anlagen.
[23] EuGH, 28.01.2025 – C‑253/23, WRP 2025, 314 ff. – ASG 2.
[24] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 17 – Geschäftsführerhaftung.
[25] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 21 – Geschäftsführerhaftung.
[26] Vgl. Wegener, in: Calliess/Ruffert, 6. Aufl. 2022, AEUV Art. 267, Rn. 24 m. w. N.
[27] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 38 – Geschäftsführerhaftung.
[28] EuGH, 11.06.2009 – C‑429/07, WuW 2009, 850 Rn. 39 – Inspecteur van de Belastingdienst/X BV.
[29] EuGH, 10.04.2014 – C‑231/11 P u.a., WuW/E EU-R 2970 Rn. 62 – Siemens Österreich; EuGH, 10.04.2014, C‑247/11 P u.a., WuW/E EU-R 2996 Rn. 152, 157 – Areva.
[30] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 42 – Geschäftsführerhaftung.
[31] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 27 – Geschäftsführerhaftung.
[32] BGH, 11.02.2025 – KZR 74/23, WRP 2025, 889, Rn. 44 – Geschäftsführerhaftung.
[33] Zur Höhe von Gericht zugesprochenen Forderungen aus Schadensersatzfolgeklage wegen Kartellen siehe: Laborde, Cartel damages actions in Europe: How courts have assessed cartel overcharges, 6e édition, Revue Concurrences 2025, abrufbar unter: https://www.concurrences.com/en/review/issues/no-6-2025/pratiques/cartel-damagesactions-in-europe-how-courts-have-assessed-cartel-overcharges.
[34] Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen, ABl. C 298 vom 8.12.2006, S. 17-22.
[35] Vgl. Spindler, in: MüKoAktG, 6. Aufl. 2023, AktG, § 93, Rn. 85.
[36] Vgl. Hölters, in: Hölters/Weber/Hölters, 4. Aufl. 2022, AktG, § 93, Rn. 80 ff. und 236.
[37] Wegen der privilegierten Arbeitnehmerhaftung kommt hier eine gestörte Gesamtschuld in Betracht.
[38] Die bislang h. M. lässt eine Vorteilsanrechnung grundsätzlich zu, vgl. Koch, in: AktG, 19. Aufl. 2025, § 93 Rn. 90.
[39] Zur Verjährung äußerte der BGH sich nicht ausdrücklich. Das OLG Düsseldorf verneinte die Verjährung, weil es sich der Ansicht anschloss, es handele sich um Dauerdelikte (OLG Düsseldorf, 27.07.2023 – VI‑6 U 1/22 (Kart), WRP 2023, 1225 ff., Rn. 118).
WRP – Wettbewerb in Recht und Praxis, 9/2025, S. 1133-1136.