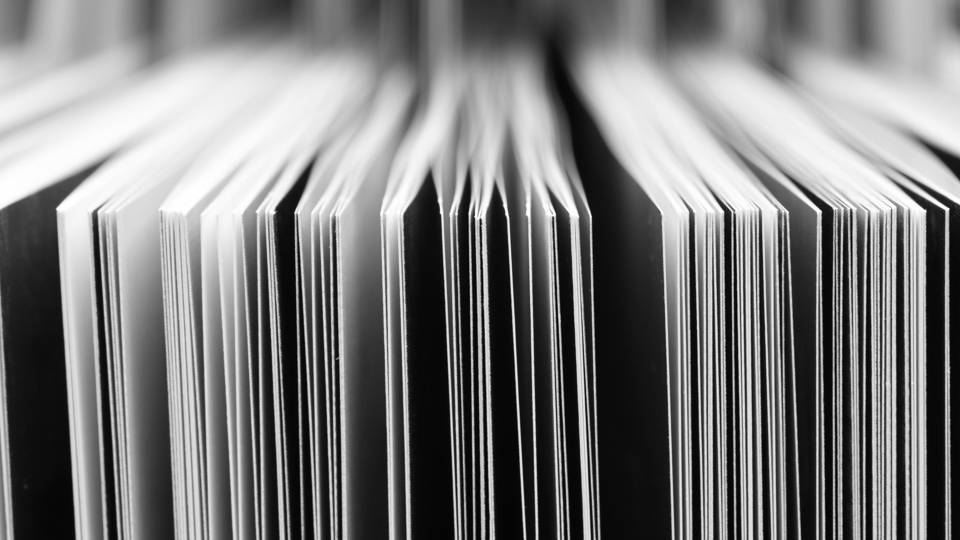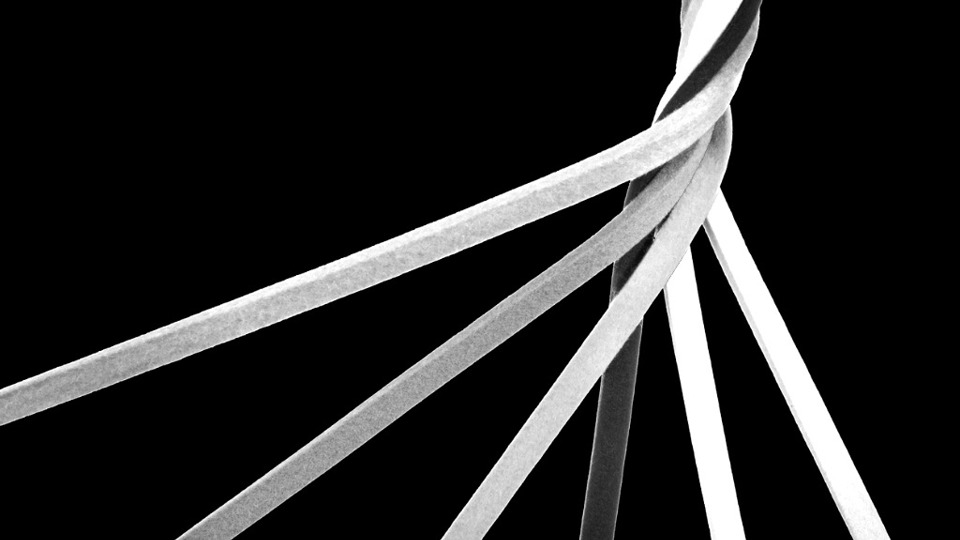Härtetest für den DMA – Erste Bußgelder gegen Meta und Apple
Die EU-Kommission hat mit den Entscheidungen zu Metas „Pay or Consent“-Modell und Apples „App Store“ die ersten beiden Bußgelder wegen Verstößen gegen den Digital Markets Act (DMA) verhängt. Beide Entscheidungen sind damit Neuland. Sie ergingen in einem schwierigen regulatorischen und politischen Umfeld und wurden so zum Stresstest für den DMA. Dieser Beitrag betrachtet beide Entscheiden näher, bewertet sie und zieht erste Schlüsse für die weitere Durchsetzungspraxis des DMA.
I. Einleitung
An den DMA sind große Erwartungen geknüpft. Er tritt neben das als zu schwerfällig empfundene Kartellrecht und soll den marktmächtigen Big Tech-Unternehmen Einhalt gebieten.[1] Er ist als kartellrechtliche ex ante-Regulierung [2] ausgestaltet, bei dem im ersten Schritt besonders marktmächtige Unternehmen in digitalen Märkten von der EU-Kommission als „Torwächter“ für eine Reihe bestimmter zentraler Plattformdienste benannt werden, für die im zweiten Schritt die Verhaltensregeln der Art. 5 bis 7 DMA gelten. Diese bilden das Herzstück [3] des DMA und sollen bestreitbare und faire Märkte im Digitalbereich gewährleisten, was sich aus der in Art. 1 Abs. 1 DMA genannten grundlegenden Zielsetzung des DMA ersehen lässt. Die regulatorische Grundidee basiert auf einem „Paradigmenwechsel“ [4] gegenüber dem klassischen Kartellrecht. Statt wie bisher erst reaktiv gegen Wettbewerbsverstöße vorzugehen, soll es entweder erst gar nicht zu Verstößen gegen die Art. 5 bis 7 DMA kommen oder sie sollen rasch per Nichteinhaltungsverfahren abgestellt werden. Die Nichteinhaltungsverfahren sind stark beschleunigt. So soll gemäß Art. 29 Abs. 2 DMA regelmäßig eine Entscheidung der EU- Kommission binnen eines Jahres ergehen. Sie kann hierbei nicht nur die Abstellung des Verstoßes anordnen, sondern gemäß Art. 30 DMA empfindliche Bußgelder von 10% bzw. 20% des Konzernumsatzes verhängen. Bei systematischer Nichteinhaltung sind nach Art. 18 DMA weitergehende Sanktionen möglich.
Als die sieben Torwächter – Alphabet (Google), Amazon, Apple, Booking.com, Byte Dance (TikTok), Meta und Microsoft – ihre ersten Compliance-Berichte am 07.03.2024 veröffentlichten, ließ sich schnell erster Widerstand erkennen. Vor allem Apple [5] zeigte sich widerspenstig. Nachdem die EU-Kommission sodann sechs Nichteinhaltungs- und zwei Spezifizierungsverfahren gegen Torwächter eröffnet hatte, [6] folgte ein erfolgreiches öffentliches Lobbying der betroffenen Unternehmen Apple, Meta und Google gegenüber der US-Politik. [7] Zwischenzeitlich kamen sogar Zweifel [8] auf, ob die EU-Kommission dem politischen Druck standhalten würde, und so wurden die ersten beiden anstehenden Entscheidungen gegen Meta und Apple zum Härtest für den DMA. Wäre die EU-Kommission gänzlich eingeknickt oder hätte auf Bußgelder verzichtet, wäre das ein fatales Signal für den DMA gewesen. Es kam bekanntlich anders und die EU-Kommission verhängte am 23.04.2025 Bußgelder in Höhe von EUR 200 Mio. gegen Meta [9] bzw. EUR 500 Mio. gegen Apple.[10] Nachdem die Entscheidungen zwischenzeitlich im Volltext veröffentlicht sind, lohnt es, diese näher zu beleuchten. Denn wie sich noch zeigen wird, lassen sich hieraus wichtige Erkenntnisse für die künftige DMA-Durchsetzung gewinnen. Dieser Beitrag betrachtet daher die Bußgeldentscheidungen zu Metas „Pay or Consent“-Modell (II.) und Apples „App Store“ (III.). Da die Entscheidungen mit 77 bzw. 66 Seiten recht umfangreich ausfallen, der Rahmen dieses Beitrags jedoch begrenzt ist, sind sie sehr knapp zusammengefasst. Der Beitrag schließt mit einem kurzen Fazit (IV.).
II. Die ,,Pay or Consent“-Entscheidung
1). Das Verbot der Datenkombination in Art. 5 Abs. 2 DMA und Metas „Pay or Consent“-Modell
Meta ist u.a. als Torwächter für seine sozialen Netzwerke Facebook und Instagram bestimmt worden. Das Unternehmen muss sich demzufolge an das Verbot der Datenkombination nach Art. 5 Abs. 2 DMA halten. Vereinfacht gesprochen, darf der Torwächter hiernach nur personenbezogene Daten der Endnutzer seiner zentralen Plattformdienstleistungen aus verschiedenen Quellen zusammenführen, wenn er vorher die Zustimmung des jeweiligen Endnutzers einholt.[11] Dabei sind zwei Voraussetzungen zu beachten. Zum einen muss dem Endnutzer eine „spezifische Wahl“ gegeben werden. Näher konkretisiert wird dies durch die Erwägungsgründe 36 und 37 DMA. Zum anderen muss der Endnutzer seine Zustimmung nach Maßgabe von Art. 4 Nr. 11 und 7 der DSGVO erteilen, was im Kern heißt, dass diese freiwillig erfolgen muss.
Mit Blick auf die vorgenannten Vorgaben unter Art. 5 Abs. 2 DMA hat Meta im Herbst 2023 sein neues „Pay or Consent“-Modell eingeführt. Hiernach werden Endnutzer von Facebook bzw. Instagram vor eine binäre Wahl gestellt: Entweder sie stimmen der Kombination ihrer persönlichen Daten auf Meta- und Dritt- seiten zu – im Kern ermöglicht dies Meta, personalisierte Werbung zu schalten, welche aufgrund ihrer größeren Zielgerichtetheit effektiver ist und damit teurer von Meta vermarktet werden kann, und die Nutzung von Facebook und Instagram bleibt für sie weiterhin kostenfrei; oder sie lehnen die Datenkombination ab, können Facebook bzw. Instagram werbefrei nutzen, jedoch verpflichten sie sich im Gegenzug, ein monatliches Entgelt von EUR 9,99 (Web-Abo) bzw. EUR 12,99 (iOS/Android) zu entrichten.[12]
2) Das „Pay or Consent“-Modell verstößt gegen Art. 5 Abs. 2 DMA
EU-Kommission und Meta stritten sich – die Entscheidung gibt dies auf rund 40 Seiten wieder – recht umfangreich und tiefgreifend zur Frage des Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 2 DMA. Dabei prüfte die EU-Kommission nur das ursprüngliche „Pay or Consent“-Modell. Meta hatte am 22.11.2024 nämlich noch eine zusätzliche, dritte Option eingeführt. Hiernach könne der Endnutzer einer Nutzung von Facebook bzw. Instagram zustimmen, bei der weniger persönliche Daten genutzt werden und bei denen eine nicht überspringbare Werbeeinblendung erscheine. Bei dieser Option falle das monatliche Entgelt mit EUR 5,99 bzw. EUR 7,99 (Android/iOS) geringer aus.[13]
Der EU-Kommission zufolge verstößt das ursprüngliche, binäre „Pay or Consent“-Modell in zweifacher Weise gegen Art. 5 Abs. 2 DMA. Zum einen biete es Endnutzern keine spezifische Wahl, weil eine nicht personalisierte Nutzung nur gegen ein monatliches Entgelt angeboten werde, was keine weniger personalisierte, aber im Übrigen gleichwertige Alternative sei.[14] Zum anderen erfolge die Einwilligung der Endnutzer nicht freiwillig, weil eine nicht personalisierte Nutzung der Dienste nur gegen ein monatliches Entgelt möglich sei.[15]
Meta sah dies naturgemäß anders. Dabei bestritt das Unterneh-men bereits, dass Art. 5 Abs. 2 DMA überhaupt eine zweigliedri- ge Prüfung vorsehe, welche der Tatbestandsvoraussetzung der „spezifischen Wahl“ eine eigenständige Bedeutung zumesse.[16] Die EU-Kommission wies diese Auslegung jedoch vor allem anhand der vorgenannten Erwägungsgründe 36 und 37 des DMA zurück.[17] Zudem erfordere die „spezifische Wahl“ nach dem Dafürhalten von Meta nur, dass dem Verbraucher keine qualitativ schlechtere Nutzungsform von Facebook bzw. Instagram als Alternative angeboten werde, bei der Funktionalitäten unterdrückt werden.[18] Die EU-Kommission wies dies zurück, weil eine Alternative gegen Entgelt eine andere Form des Zugangs sei, die Nutzung gegen monatliche Entgelte bei sozialen Netzwerken unüblich sei und – wie die Zahlen beim „Pay or Cosent“-Modell zeigen – von Endnutzern kaum angenommen werde.[19] Wie interne Dokumente von Meta zeigten, sei das Unternehmen selbst davon ausgegangen, dass die ganz überwiegende Anzahl der Nutzer sich gegen die Entgeltvariante aussprechen würde.[20]
Laut EU-Kommission willigten die Endnutzer in die Datenkombination auch nicht freiwillig i. S. d. Art. 4 Nr. 11 DSGVO ein.[21] Wie der Erwägungsgrund 43 der DSGVO betone, sei die Freiwilligkeit besonders zweifelhaft, wenn zwischen dem Endnutzer und dem Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht. Nach dem Erwägungsgrund 42 der DSGVO ist eine Zustimmung nicht freiwillig, wenn der Endnutzer im Falle einer Verweigerung Nachteile erleidet. Die Ernennung als „Torwächter“ bilde bereits ein starkes Indiz für ein klares Ungleichgewicht. Überdies habe Meta durch das kostenlose Angebot von Facebook und Instagram über zwei Jahrzehnte eine große Nutzerbasis aufgebaut, die durch Netzwerkeffekte gebunden sei. Zudem seien Facebook und Instagram für viele Nutzer Teil des täglichen Lebens. Vor diesem Hintergrund sei die Option, ein nicht personalisiertes „Facebook und Instagram“ nur gegen ein monatliches Entgelt nutzen zu können, mit Nachteilen verbunden. Auch dies sah Meta anders, wobei dessen Kritik am Kern der Argumentation der EU-Kommission vorbeiging.[22]
3) Bußgeld und Abstellungsanordnung
Die Bußgeldbemessung beruht im Ausgangspunkt auf der kartellrechtlichen Methodik. Bußgelder bestimmen sich nach Art. 30 DMA über die „Dauer“ und „Schwere“ des Verstoßes, wobei sie effektiv, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen. Allerdings konnte die EU-Kommission nicht auf die detaillierten Zumessungsregeln der Bußgeldleitlinien [23] abstellen, weil diese nur für Kartellrechtsverstöße gelten. Die Verstoßdauer habe mindestens acht Monate betragen, nämlich von der Anwendbarkeit des Art. 5 Abs. 2 DMA im März 2024 bis zur Einführung der dritten Option im November 2024,[24] und war damit eher überschaubar. Größeres Gewicht legte die EU-Kommission jedoch auf die Schwere der Zuwiderhandlung. Diese erachtete die EU-Kommission aus mehreren Gründen für sehr erheblich. So habe das „Pay or Consent“-Modell in ganz Europa gegolten und eine hohe Zahl von Nutzern betroffen. Zudem sei Meta eines der größten Tech-Unternehmen der Welt, für das eine Geldbuße hinreichend abschreckend sein müsse. Allerdings attestierte die EU-Kommission auch einige mildernde Umstände. Der DMA sei eine neue Rechtsmaterie und der vorliegende Fall zähle zu den ersten Nichteinhaltungsentscheidungen unter dem DMA. Auch hätte Meta sich parallel um die Einhaltung der DSGVO, einschließlich Vorgaben der irischen Datenschutzkommission, kümmern müssen, was zusätzliche Komplexität geschaffen habe. Dementsprechend wurde das Bußgeld mit EUR 200 Mio. bemessen.
Zusätzlich ordnete die EU-Kommission an, dass Meta den Verstoß innerhalb von 60 Tagen abstellen muss. Wie die Abstellung im Einzelnen auszusehen hat, gab die EU-Kommission nicht vor. Zur (Non-)Compliance der zwischenzeitlich eingeführten dritten Option des „Pay or Consent“-Modells verhielt sie sich gar nicht. Stattdessen gab sie nur einige sehr grobe Richtlinien vor. So müsse eine weniger personalisierte, aber gleichwertige Alternative (i) neutral gestaltet sein, (ii) soweit sie Werbung beinhaltet, dürfe sie keine persönlichen Daten verarbeiten (d. h. personalisiert sein) und (iii) qualitativ nicht schlechter sein; weshalb – soweit Facebook und Instagram mit Datenkombination kostenlos bleiben – auch die Alternative keine Gebühr vorsehen dürfe.
4) Bewertung
Insgesamt ist die Bußgeldentscheidung zum „Pay or Consent“- Modell positiv zu bewerten.
Zunächst ist die zügige Verfahrensführung zu begrüßen. Die EU- Kommission zeigte ihre Bedenken am „Pay or Consent“-Modell rasch und leitete das Nichteinhaltungsverfahren gegen Meta bereits am 25.03.2024 ein, also nur drei Wochen nach dem Inkrafttreten des Art. 5 Abs. 2 DMA am 07.03.2024.[25] Der Verfahrensabschluss folgte im April 2024 und lag nur knapp oberhalb der Regelfrist. Ob sich Nichteinhaltungsverfahren tatsächlich innerhalb der einjährigen Regelfrist bewältigen lassen, war mit Zweifeln behaftet. Die EU-Kommission hat nun gezeigt, dass es gelingen kann. Auch wenn die Konzeption des DMA mit seinen per se Regeln und der vorherigen Klärung der Anwendungsfragen (Gatekeeper-Designation) die Arbeitslast reduziert, war innerhalb des Jahres Erhebliches zu leisten. So war der aufzubereitende Sachverhalt komplex und es stellten sich rechtliche Grundsatzfragen. Daneben hatte die EU-Kommission richtigerweise Dritte am Verfahren beteiligt, sich insbesondere mit der irischen Datenschutzbehörde abgestimmt und Verbraucherschutzorganisationen zu Wort kommen lassen. Die Ergebnisse waren sodann in einer förmlichen Entscheidung aufzubereiten, die mit 77 Seiten recht umfangreich ausfiel. Das alles war nur durch eine sehr straffe Verfahrensführung zu leisten, der auch die begrenzten Kapazitäten und mehrere parallel geführte Verfahren unter dem DMA nicht entgegenstanden.
Die Auslegung der EU-Kommission zu Art. 5 Abs. 2 DMA überzeugt. Das gilt sowohl für die Zweigliedrigkeit der Prüfung als auch, was die inhaltlichen Anforderungen an die Begriffe der „spezifischen Wahl“ und der „Freiwilligkeit“ der Zustimmung anbelangt. Vor allem ist es im Sinne des Schutzzwecks des DMA, der zum Nutzen von gewerblichen und Endnutzern bestreitbare und faire Märkte schaffen will, und dem Grundsatz der praktischen Wirksamkeit („effet utile“) richtig, auf die tatsächlichen Verhältnisse abzustellen. Theoretische Wahlmöglichkeiten, die für Verbraucher praktisch nicht in Frage kommen – unter 1% der Nutzer hatten sich für die Bezahlvariante entschieden –, sind unzureichend.
Die Bewertung des Bußgelds fällt gemischt aus. Dass die EU-Kommission überhaupt ein Bußgeld verhängt hat, war richtig und wichtig. Hätte sie nur eine Abstellungsverfügung erlassen (und sich insoweit dem US-Druck gebeugt), wäre dies ein fatales Signal an die Torwächter gewesen. Denn die Botschaft wäre gewesen, dass eine unzureichende Umsetzung von DMA-Pflichten keine harten Konsequenzen nach sich zieht. Das hätte ein Kalkül ermöglicht, es zunächst mit einer hinter den gebotenen Anforderungen zurückbleibenden Minimallösung zu versuchen. Allerdings fallen die EUR 200 Mio. wiederum nicht allzu hoch aus –sie entsprechen nur rund 0,1% von Metas vorjährigem Konzernumsatz.
Wichtiger wird ohnehin die Umsetzung der Abstellungsanordnung sein. Die EU-Kommission blieb in der Entscheidung hierzu vage. Obgleich sie die zwischenzeitlich geschaffene dritte Option nicht in die Entscheidung einbezogen hatte, wird aus ihren wenigen Vorgaben bereits klar, dass deren Einführung keine Compliance mit Art. 5 Abs. 2 DMA bewirkt. Denn solange die Nutzung von Facebook bzw. Instagram mit Datenkombination kostenlos bleibt, muss auch die Alternative ohne Datenkombination kostenlos bleiben. Obgleich die EU-Kommission noch vor Zwangsgeldern im Juni 2025 warnte,[26] beharrte Meta einen Monat später darauf, sein „Pay or Consent“-Modell nicht weiter zu verändern.[27] Da eine gerichtliche Anfechtung der Bußgeldentscheidung nach Art. 278 S. 1 AEUV keine aufschiebende Wirkung hat, droht sich der Konflikt weiter zuzuspitzen.
Presseberichten [28] zufolge soll Meta die Entscheidung vor dem EuG angefochten haben. Das war zu erwarten und es wird sich – unabhängig von der Entscheidung des EuG – angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der Sache aller Voraussicht nach eine Revision zum EuGH anschließen. Allerdings wird vor den europäischen Gerichten deutlich weniger Raum für politische Einflussnahme bestehen. Denn sie sind noch weniger als die EU-Kommission hierfür empfänglich und agieren gänzlich unabhängig. Dort wird es rein auf die juristische Qualität der Argumente ankommen und politisches Säbelrasseln wird nicht verfangen.
III. Die „App Store“-Entscheidung
1). Das Anti-Steering-Verbot des Art. 5 Abs. 4 und Apples Geschäftsbedingungen
Apple ist hinsichtlich seines App Stores ein Torwächter, weshalb das Unternehmen das Anti-Steering-Verbot des Art. 5 Abs. 4 DMA einzuhalten hat. Hiernach muss es gewerblichen Nutzern (sprich den App-Entwicklern) erlaubt sein, den von ihnen akquirierten Endnutzern kostenlos Angebote zu unterbreiten, diese zu bewerben und mit ihnen unmittelbar Verträge zu schließen. Kurzum: Die App-Entwickler müssen Endnutzer aus der über den App Store installierten App zu anderen, vor allem eigenen Verkaufskanälen steuern (steeren) dürfen. Weiter konkretisiert wird das Anti-Steering-Verbot durch den Erwägungsgrund 40 des DMA.
Unter Apples ursprünglichen Geschäftsbedingungen29) war den App-Entwicklern ein Steering vollständig untersagt. Um den Anforderungen des Art. 5 Abs. 4 DMA zu entsprechen, hat Apple neue Geschäftsbedingungen eingeführt. Neben den generellen Geschäftsbedingungen gab es noch spezielle für Anbieter von Music Streaming-Diensten, auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soll. Die neuen Geschäftsbedingungen traten jedoch nur ergänzend zu den ursprünglichen in Kraft, d. h. App- Entwickler konnten sich für die neuen entscheiden oder weiterhin die bisherigen nutzen. Die neuen Geschäftsbedingungen enthielten dabei ein neues Gebührensystem. Anstelle der einheitlichen 15% bzw. 30% Kommission, die Apple bislang für In-App- Käufe vorsah, gab es drei verschiedene Gebühren, die auch kumulativ anfallen konnten: (i) 10% bzw. 17% für In-App-Käufe und bei Link Out-Käufen, die innerhalb von sieben Tagen nach Klicken des Links getätigt wurden, (ii) 3% bei Nutzung von Apples Zahlungssystem (was aber App-Entwickler nicht nutzen durften, die auch anderweitig an Endkunden verkaufen wollten, und (iii) eine Core Technology Fee von EUR 0,50 für Downloads von Apps.[30] Obgleich App-Entwicklern nunmehr ein Steering er- laubt ist, war dies gleich mehrfach eingeschränkt: (i) Sie konnten die App nur auf ihre App-Entwickler-Internetseite verlinken, (ii) es war nur ein Link per Storefront möglich, (iii) der Link funktionierte nur über den Browser und (iv) bei Anklicken des Links öffnete sich ein Warnfenster, (v) über den Link war keine Autofill-Funktion möglich, so dass die Endkunden ihre Zahlungsdaten neu eingeben müssten.[31] Weitere Steering-Möglichkeiten jenseits der Link Outs (z. B. durch Einblenden von Pop Up Messages) waren nicht vorgesehen und damit im Zweifel nicht erlaubt.
2). Apples Geschäftsbedingungen verstoßen gegen Art. 5 Abs. 4 DMA
Apples ursprüngliche Geschäftsbedingungen verstoßen klar gegen Art. 5 Abs. 4 DMA, weil sie keinerlei Steering durch App- Entwickler erlauben. Das räumte auch Apple ein. Allerdings verwarf die EU-Kommission Apples Ansatz, wonach dieses Defizit behoben werde, indem App-Entwickler die neuen (vermeintlich DMA-konformen) Geschäftsbedingungen wählen könnten.[32] Es müssten alle geltenden Geschäftsbedingungen jeweils dem DMA entsprechen. Es widerspräche nämlich dessen Zielsetzung, wenn ein Torwächter unzureichende Geschäftsbedingungen weiterverwenden könne, nur weil sich Nutzer gegen einen Wechsel entschieden hätten. Überdies seien Apples neue Geschäftsbedingungen mit erheblichen Nachteilen für App-Entwickler verbunden, sehen etwa die Zahlung der Core Technology Fee vor.
Die EU-Kommission erachtete jedoch auch Apples neue Geschäftsbedingungen als unzureichend. Sie verstoßen ebenfalls gegen das Anti-Steering-Verbot des Art. 5 Abs. 4 DMA, weil sie (i) App-Entwickler in ihren Möglichkeiten Angebote an Nutzer zu kommunizieren und zu bewerben in der App einschränken und (ii) es ihnen auch nicht gestatten, kostenlos Verträge mit End- verbrauchern abzuschließen.
Dass die neuen Geschäftsbedingungen nur Link Out-Möglichkeiten vorsahen, nicht jedoch andere Steering-Formen erlaubten, reichte für die EU-Kommission bereits aus, um einen Verstoß gegen Art. 5 Abs. 4 DMA zu begründen.[33] Allerdings seien auch die vorgesehenen Link Outs in gleich mehrfacher Hinsicht zu restriktiv. Entgegen Apple gebiete die Vorschrift nicht nur, eine Möglichkeit der Endkundenansprache zuzulassen. Vielmehr müssten App-Entwickler auch innerhalb der App frei darüber entscheiden können, wie sie mit Endnutzern kommunizieren (z. B. auch mit E-Mail-Buttons oder Buy-Buttons). Eine dahingehende Auslegung von Art. 5 Abs. 4 DMA gebiete der Effektivitätsgrundsatz, folge aber auch aus dem Erwägungsgrund 40 des DMA.[34] Das Einräumen von rein theoretischen Kommunikationswegen, die unpraktikabel seien, reiche gerade nicht aus. Wegen ihrer zahlreichen Restriktion lasse sich mithilfe der Link Outs kein effektives Steering betreiben. Dabei erachtete die EU-Kommission auch die einzelnen Beschränkungen der Link Outs (z. B. nur Verlinkung auf die Internetseite des App Developers, Begrenzung auf eine URL per Storefront, kein Web View, wiederholte Warnhinweise etc.) jeweils für sich genommen als unzuläs- sig.[35] Auch hinsichtlich der Möglichkeit von App-Entwicklern, mit Endkunden auf anderen Vertriebswegen Verträge zu schließen, müsste der Torwächter effektive Mittel zulassen.[36] Erneut sprach sich Apple vergeblich für die engere Sichtweise aus, wonach nur eine Form des Vertragsschlusses ermöglicht werden müsse.
Laut EU-Kommission müssten App-Entwickler mit Endkunden Verträge kostenlos schließen können. Art. 5 Abs. 4 DMA verbiete es dem Torwächter, nicht nur Entgelte für Steering zu erheben, sondern auch für Verträge vorzusehen, die mittels Steerings zustande kommen. Aus dem Erwägungsgrund 40 DMA folge allein, dass ein Torwächter ein Entgelt für seinen Beitrag zur ursprünglichen Akquisition des Endkunden erheben könne. Hierunter ließen sich allenfalls (Einmal-)Zahlungen fassen, die zeitnah anfielen, nachdem ein Nutzer die App installiert hat und sodann einen Kauf tätige. Apples Gebühren entstünden hingegen fortlaufend bei allen Käufen, die Endkunden sieben Tage nach Klicken des Link Out tätigen.
3). Abstellungsanordnung und Bußgeld
Die Bußgeldbemessung richtet sich ebenfalls nach der „Dauer“ und „Schwere“ des Verstoßes, wobei die EU-Kommission erneut mehr Gewicht auf die Schwere des Verstoßes legte. Hinsichtlich der Dauer stellt die Entscheidung nur kurz klar, dass die Zu- widerhandlung mit Inkrafttreten von Art. 5 Abs. 4 DMA eingesetzt habe und noch fortlaufend sei.[37] Hinsichtlich der Schwe- re erachtet die EU-Kommission – wie schon im Fall von Meta – den Verstoß für sehr erheblich. Die Begründung ist die gleiche (Business Terms gelten in ganz Europa, hohe Zahl von Nutzern betroffen, Größe von Apple). Zudem erkannte die EU-Kommission die gleichen mildernden Umstände an (DMA als neue Rechtsmaterie, eine der ersten Nichteinhaltungsentscheidungen). Weshalb das Bußgeld gegen Apple mit EUR 500 Mio. mehr als doppelt so hoch wie das gegen Meta ausfiel, begründet die Entscheidung nicht. Ob es an der längeren Verstoßdauer, dem fehlenden dritten Milderungsgrund, dem höheren Konzernumsatz oder anderen Umständen lag, bleibt damit das Geheimnis der EU-Kommission.
Auch die Abstellungsanordnung weist starke Parallelen zur Bußgeldentscheidung gegen Meta auf. Apple hat den Verstoß ebenfalls innerhalb von 60 Tagen abzustellen. Erneut gab die EU-Kommission nicht genau vor, wie die Abstellung im Einzelnen aussehen muss, und verhielt sich nicht zur (Non-)Compliance der zwischenzeitlich angekündigten, aber nicht umgesetzten neuen Geschäftsbedingungen aus dem August 2024.[38] Allerdings machte sie sowohl zum Steering durch App-Entwickler als auch zu deren Recht, kostenfrei Verträge mit Endnutzern zu schließen, wenn diese per Steering zustande gekommen sind, einige Vorgaben.[39] So müssten App-Entwickler Endkunden effektiv bewerben und Verträge schließen können. Apple müsse diesbe- züglich unter anderem sicherstellen, dass App-Entwickler (i) Endkunden auf jeglichem Kanal ihrer Wahl ansprechen (wobei auch die Zahl der Zielseiten nicht begrenzt sein dürfe) und diese zu- sätzlichen Daten „mitnehmen“ (vor allem um Felder vorauszu- füllen) dürfen, (ii) Endkunden jegliche Angebote unterbreiten dürfen und (iii) nach dem Steering mit Endkunden in jeglicher Form Verträge schließen dürfen, einschließlich unter Einsatz des Web Views. Zudem müssten (iv) Warnhinweise von Apple oder vergleichbare Maßnahmen neutral gestaltet sein und müssen objektiv notwendig und verhältnismäßig sein. Was wiederum die Kostenfreiheit der Verträge anginge, müsse diese grundsätzlich gewährleistet sein, wobei Apple allein ein Entgelt für dessen Beitrag zur anfänglichen Akquise von Endkunden vorsehen könne; dieses müsse in sachlicher und zeitlicher Hinsicht auf den anfänglich geleisteten Beitrag beschränkt, in der Höhe gerechtfertigt und dürfe kein reine „Torwächter-Mehrwert“-Gebühr sein, die sich letztlich auf einen Mehrwert gründet, der darin besteht, dass eine Leistung nicht von irgendjemand erbracht wird, sondern von einem Torwächter, der geschäftlichen Nutzern ein wichtiges Zugangstor zu Endnutzern eröffnet.[40]
4). Bewertung
Die „App Store“-Entscheidung ist ebenfalls positiv zu bewerten.
Dabei gibt es einige Parallelen zur Entscheidung gegen Meta. Auch hier hat die EU-Kommission gezeigt, dass sie die ambitionierte Jahresfrist in Nichteinhaltungsverfahren bei einer zügigen Verfahrensführung wahren kann. Obgleich beim „App Store“- Fall weniger Abstimmungsbedarf bestand, galt es zahlreiche Regelungen in den verschiedenen Geschäftsbedingungen Apples zu bewerten und sich mit Apples Einwänden auseinanderzusetzen.
Die Auslegung der EU-Kommission zum Anti-Steering-Verbot des Art. 5 Abs. 4 DMA, die ebenfalls auf eine effektive Wirksamkeit der Vorschrift abzielt, ist deutlich überzeugender als die von Apple vertretene formale Sichtweise, bei der App-Entwicklern ein Steering letztlich nur theoretisch möglich war, weil es mit zu vielen praktischen Nachteilen und Beschränkungen verbunden war. Auch wies die EU-Kommission Apples Geschäftsbedingungen zu Recht deutlich zurück. Schon das Weiterverwenden der alten, unstrittig unzureichenden Geschäftsbedingungen, ist ein klarer Verstoß gegen Art. 5 Abs. 4 DMA. Allerdings war auch das Link Out- System der neuen Geschäftsbedingungen viel zu restriktiv, sowohl was die einzelnen Beschränkungen angeht als auch deren Wirkung in Summe. Stellvertretend sei hier nur der Warnhinweis genannt, der bei jedem Betätigen des Link Outs erschien und klar einschüchternd (scare screen) ausgestaltet war.[41]
Auch in dieser Sache war es wichtig, dass die EU-Kommission ein Bußgeld verhängt hat. Es fällt mit EUR 500 Mio. deutlich höher aus. In der Sache ist das auch begründet, zumal die Verstoßdauer länger war und Apples Konzernumsatz mit rund USD 391 Mrd. (2024) den von Meta (rund USD 164 Mrd.) deutlich übersteigt. Obgleich die EU-Kommission dies nicht benannte, darf auch die Vorgeschichte der „App Store“-Entscheidung nicht vergessen werden: So hatte die EU-Kommission bereits im März 2024 ein Bußgeld in Höhe von EUR 1,8 Mrd. gegen Apple in Sachen Music Streaming Services [42] verhängt, weil dessen Anti-Steering-Regeln gegen Art. 102 AEUV verstießen. Dementsprechend musste Apple mit der Thematik bestens vertraut gewesen sein. Dass das neue Anti-Steering-Verbot unter dem DMA als per se Regel strenger ist als Art. 102 AEUV, dürfte auch Apple nicht verborgen geblieben sein.
Da Apple das Bußgeld wirtschaftlich nicht hart trifft, kommt es ebenfalls entscheidend auf die Umsetzung der Abstellungsanordnung an. Hier machte die EU-Kommission Apple klarere Vorgaben, was hoffnungsvoll stimmt. Ob die von Apple zwischenzeitlich angekündigten, aber nicht umgesetzten Geschäftsbedingungen mit Art. 5 Abs. 4 DMA vereinbar sind, ließ die EU-Kommission hingegen offen.[43] Immerhin sind sie deutlich liberaler ausgestaltet und scheinen vielen der Vorgaben zu entsprechen, weshalb sich diese als Ausgangspunkt anbieten. Ob Apple den entsprechenden Willen hat, rasch Compliance zu schaffen, dürfte angesichts dessen gesamten bisherigen Auftretens jedoch bezweifelt werden. Dementsprechend wird die EU-Kommission erheblichen Widerstand zu überwinden haben.
Laut Presseberichten [44] soll Apple die Entscheidung vor dem uG angefochten haben und man darf sich auch hier auf einen langwierigen Rechtstreit einstellen, der jedoch weitestgehend frei von politischem Einfluss bleiben sollte.
IV. Fazit
Aus den ersten beiden Bußgeldern gegen Meta und Apple lassen sich wichtige Erkenntnisse für die weitere Durchsetzungspraxis des DMA entnehmen.
Zunächst wird klar, dass sich die EU-Kommission nicht dem politischen Druck beugt. Sie besteht auf einer effektiven, praktisch wirksamen Durchsetzung des DMA und erteilt Versuchen einer Schein-Compliance von Meta und Apple, bei der pro forma-Maß- nahmen getroffen wurden, welche dem Praxistest ganz offensichtlich nicht standhalten, eine klare Absage. Dies schließt auch die Verhängung von dreistelligen Millionenbußgeldern ein. Trotz der Diskussion, ob der DMA im Zollstreit mit den USA als Verhandlungsmasse herhalten muss,[45] und dem jüngsten Mäandern der EU-Kommission in Sachen Google Adtech [46] – dort hatte sie die Entscheidung zunächst verschoben und womöglich bei der Bußgeldhöhe, die mit rund EUR 2,95 Mrd. noch immer sehr hoch ausfiel, gewisse Zugeständnisse gemacht [47] –, scheint sie weiterhin an ihrer Linie festzuhalten, gegen Verstöße der Torwächter trotz allen transatlantischen Missmuts einzuschreiten. Freilich wird sie hier noch einen langen Atem haben müssen. Denn die Torwächter werden kontinuierlich Widerstand leisten und ihre bisherigen Geschäftsmodelle verteidigen, welche die Unbestreitbarkeit ihrer Stellung zementieren.
Was sich bereits angekündigt hatte und sich bei den ersten Bußgeldern nun bewahrheitet, ist, dass die Torwächter die Entscheidungen jeweils gerichtlich anfechten. Das ist in der Sache nicht zu beanstanden und ihr gutes Recht. Allerdings wird dies zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten führen, welche die ohnehin bereits knappen Ressourcen der EU-Kommission weiter binden. Da die EU-Kommission nicht mehr Ressourcen zur DMA-Durch- setzung erhalten wird und die nationalen Wettbewerbsbehörden, die auch Vorermittlungen führen dürfen, nicht im großen Stil zu Hilfe kommen werden, wird sie künftig noch stärker priorisieren müssen, als sie es bislang ohnehin tut. Dementsprechend könnte die private Durchsetzung des DMA in den kommenden Jahren eine zunehmende Rolle einnehmen.[48] Erste interessante Verfahren gibt es mit dem Fall 1&1 Mail & Media/Google gegen Google mit einer Unterlassungsklage vor dem LG Mainz bereits.[49]
Was die weitere öffentliche Durchsetzung des DMA angeht, wird deren Erfolg entscheidend von den Abhilfemaßnahmen abhängen. Je konkreter die EU-Kommission in den Abstellungsverfügungen wird, desto eher wird sie auf bestimmte Lösungen dringen können und vermeidet weiteren Folgestreit, ob etwaige Änderungen ausreichend sind. Dabei wird sie gut beraten sein, beharrlich zu bleiben und auf eine zügige Umsetzung zu drängen. Notfalls muss sie Zwangsgelder verhängen, um so ein Einlenken zu erzwingen. Die bisherige Praxis zu den kartellrechtlichen Abstellungsverfügungen in Digitalfällen darf ihr hier kein Vorbild sein. Dort waren die Ergebnisse meist enttäuschend.[50]
Obgleich die ersten beiden Bußgeldentscheidungen von Entschlossenheit zeugen, gilt es weiterhin am Ball zu bleiben und dem stetigen politischen Druck aus den USA nicht nachzugeben. Leider ist von den dortigen Kartellbehörden bzw. -gerichten wenig Schützenhilfe zu erhoffen. Denn zur möglichen Aufspaltung von Google im U. S.-amerikanischen Monopolisierungsverfahren wird es vorerst nicht kommen.[51] Dementsprechend wird es Europa selbst richten müssen. Allerdings kann dies im Zusammenspiel zwischen einer entschlossenen EU-Kommission und mutigen Zivilgerichten durchaus gelingen. Das Projekt „DMA“ bleibt also lebendig.
Fußnoten:
RA Dr. René Galle, Hamburg.
Mehr über den Autor erfahren Sie auf S. 1655. Der Beitrag spiegelt ausschließlich seine persönliche Meinung wider.
[1] Achleitner, NZKart 2022, 359, 360; Wielsch, ZUM 2023, 153, 154. Vgl. Kieß, Regulie- rung von digitalen Plattform-Ökosystemen, 2023, S. 121 f.
[2] Vgl. Erwägungsgründe 67 S. 3 und 73 S. 2 DMA.
[3] So etwa Hegener, RDi 2024, 267, 270; Herbers, RDi 2022, 252; Schwab, in: Podszun, DMA, 2023, Art. 5 Abs. 1 Rn. 1.
[4] So Drewes/Meyer/Moss, RDi 2024, 310, 313.
[5] Vgl. Apple, Non-Confidential Summary of DMA Compliance Report, 07.03.2024, https://www.apple.com/legal/dma/NCS-October-2024.pdf; S. 1: „The DMA requires changes to this system that bring greater risks to users and developers.“ Siehe dazu auch: Richter/Galle, WRP 2025, 844 f.
[6] Zu den einzelnen Verfahren siehe: Richter/Galle, WRP 2025, 845 ff.
[7] Vgl. Zum Einwirken von Apple, Meta und Google auf die US-Politik, siehe https:// www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/trump-eu-apple-meta-google-amazon- musk-dma-100.html. Zu Präsident Trumps Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, siehe https://www.nytimes.com/2025/01/23/us/politics/trump-davos-eu rope-tariffs.html. Siehe weiter den Brief des Judicial Committees des U. S. Kongresses vom 23.02.2025: https://judiciary.house.gov/sites/evo-subsites/republicans-judicia ry.house.gov/files/evo-media-document/2025-02-23%20JDJ%20SF%20to%20Ribera% 20re%20DMA.pdf
[8] In öffentlichen Verlautbarungen wurde dies jedoch zurückgewiesen, https://www.wsj.com/tech/eu-lawmakers-push-back-on-u-s-criticism-of-tech-antitrust-regulation- 70b73e1d .
[9] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/competition/digital_markets_act/cases/202525/DMA_100055_528.pdf.
[10] EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/competition/digital_markets_act/cases/202523/DMA_100109_ 929.pdf.
[11] Ausführlicher zum Inhalt und Schutzzweck des Art. 5 Abs. 2 DMA siehe: Göhsl/Zim- mer in: Immenga/Mestmäcker, 7. Aufl. 2025, VO (EU) 2022/1925 Art. 5 Rn. 19-23.
[12] Ausführlicher zum Pay-or-Consent-Model, siehe EU-Kommission, DMA.100055, Ent- scheidung vom 23.04.2025, Rn. 77 f.
[13] Vgl. EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 26 f.
[14] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 84.
[15] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 84.
[16] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 43 ff.
[17] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 36 f. u. 56 f.
[18] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 114.
[19] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 89 bis 95.
[20] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 96.
[21] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 176 ff.
[22] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 203 ff.
[23] EU-Kommission, Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Art. 23 Abs. 2 lit. a) der VO (EG) Nr. 1/2003, ABl. 2006/C 210/02.
[24] EU-Kommission, DMA.100055, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 308.
[25] Zum Verfahrensablauf im Einzelnen siehe EU-Kommission, DMA.100055, Entschei- dung vom 23.04.2025 (Fn. 9), Rn. 9 ff.
[26] https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/meta-will-only- make-limited-changes-pay-or-consent-model-eu-says-2025-06-27/.
[27] https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/meta-wont-tweak- pay-or-consent-model-further-despite-risk-eu-fines-sources-say-2025-07-11/.
[28] https://www.belganewsagency.eu/meta-appeals-200-million-eu-fine-over-data-practices; https://research.hktdc.com/en/article/MjEwNTA0NDkwMQ.
[29] Dazu näher: EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 29 f.
[30] Zu den Details der Gebühren, siehe EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 35.
[31] Zu den Details der Restriktionen siehe, EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 36.
[32] EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 47 ff.
[33] EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 58.
[34] EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 60 bis 62 und 72.
[35] Siehe etwa: EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 90 ff.
[36] EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 80 bis 84 und 87.
[37] EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 296.
[38] Vgl. dazu EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 18.
[39] EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 312.
[40] EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Fn. 240.
[41] Ein Screenshot findet sich in EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 36.
[42] EU-Kommission, AT.40437 – App Store Practices (Music Streaming), Entscheidung vom 04.03.2024, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/ 202419/AT_40437_10026012_3547_4.pdf.
[43] Siehe dazu EU-Kommission, DMA.100109, Entscheidung vom 23.04.2025 (Fn. 10), Rn. 42-46.
[44] https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/apple-takes-fight- against-587-million-eu-antitrust-fine-court-2025-07-07/; https://www.golem.de/news/ digital-markets-act-apple-zieht-gegen-500-millionen-bussgeld-vor-gericht-2507-1978 47.html?utm_source=chatgpt.com.
[45] https://startupverband.de/news/newsbite-startup-verband-digital-markets-act-verhan dlungsmasse-usa-eu-zollstreit/?utm_source=chatgpt.com.[46] EU-Kommission, AT.40670 – Google - Adtech and Data-related practices, Entschei- dung vom 05.09.2025 (bislang noch unveröffentlicht), PM abrufbar unter: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1992.
[47] Zu den Spekulationen siehe: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-kommission- google-erhaelt-fast-3-milliarden-euro-bussgeld-wegen-adtech-110673181.html.
[48] Siehe zum aktuellen Stand: Richter/Galle, WRP 2025, 847 ff.
[49] LG Mainz, 12.08.2025 – 12 HK O 32/24, n. v. Siehe jedoch die Meldung von 1&1: https://home.1und1.de/magazine/in-eigener-sache/google-e-mail-alternativen- android-einrichtung-zulassen-41305304.
[50] So auch Podszun mit Blick auf die bislang gegen Google verhängten Abhilfemaßnah- men in der FAZ vom 05.09.2025, https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-kommis sion-google-erhaelt-fast-3-milliarden-euro-bussgeld-wegen-adtech-110673181.html.
[51] Siehe die 230-seitige Entscheidung des District Court of Columbia vom 02.09.2025 in Sachen U. S. v. Google LLC (Case No 20-cv-3010 (APM)) und Colorado v. Google LLC (Case No. 20-cv-3715 (APM)). Sie ist abrufbar unter: https://lareclame.fr/wp-con tent/uploads/2025/09/verdict-google-mehta.pdf. Zur Presseberichterstattung siehe: https://www.nytimes.com/2025/09/02/technology/google-search-antitrust-decision. html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare.